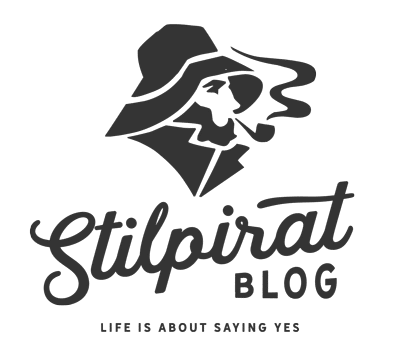Es gibt Tage, die bleiben für immer – Kpandu
 Es gibt Tage, die bleiben für immer. Unauslöschlich geschrieben ins Gedächtnis, mit Geschichten die man irgendwann später mal am Kamin an kalten Wintertagen erzählt, in der Hand einen Punsch. Und dann werde ich den großen, schweren Ghana-Bildband hervorholen und davon berichten, wie mich der Tag damals am Volta-See einfing.
Es gibt Tage, die bleiben für immer. Unauslöschlich geschrieben ins Gedächtnis, mit Geschichten die man irgendwann später mal am Kamin an kalten Wintertagen erzählt, in der Hand einen Punsch. Und dann werde ich den großen, schweren Ghana-Bildband hervorholen und davon berichten, wie mich der Tag damals am Volta-See einfing.
Er begann in diesem Guesthouse, das den Namen nicht wert war. Kein fliessend Wasser, laut und dreckig und mit einem letzten Tropfen brauner Brühe in einem Eimer, der im Badezimmer stand und in dem sich zwei Gekkos breit gemacht hatten. Die daumengroße Kakerlake, verendet im Duschbecken, mein verschwitzter, staubiger Körper, bei 30 Grad Raumtemperatur, liegend unter einem lauten Deckenventilator um 5 Uhr morgens, zeitgleich der laute Ruf des Muezzins: nichts deutete darauf hin, daß wir zusammen finden werden – der Tag und ich. Zu unwirklich das alles. Und doch bemühte er sich und gewann.
Wir sind in Kpandu, einem kleinen Fischerort am Voltasee. Der Ort ist unscheinbar, laut, benebelt und doch von seltsam-sperrigem Charme. Kein Restaurant, kein Hotel, kein irgendwie gearteter, touristischer Hotspot, nichts aber auch gar nichts, will hier dem Reisenden einen Gefallen tun. Und doch gehen wir sehr früh schon zum Ufer des Volta-Sees und beobachten das Treiben der Dorfbewohner an diesem nebligen Morgen. Man grüßt uns herzlich und zieht befremdlich die Augenbrauen nach oben, als wir erklären, daß wir einfach nur herumreisen. Eine Fähre würde gehen – auf die andere Seite des Volta Sees. Allerdings sei gerade eine Beerdigungs- und eine Geburtsfeier im Ort, deshalb müsste man erstmal sehen, ob es genügend Fahrgäste gäbe. Irgendwas um 14 Uhr könnten wir wiederkommen, so die drei auf der Bank, die eigentlich das Boot reparieren. Eigentlich. Aber zu sehen gäbe es in Kpando nichts.
Wir folgen der Strasse und platzen in die Geburtsfeier. Es sei egal, ob gerade jemand geboren wurde oder ob jemand gestorben ist, so die Auskunft – gefeiert wird bei jedem Anlass. Und wir sehen tanzende Mädchen und hören laute Musik. Es wird reichlich getrunken und gegessen. Jeder sei hier Willkommen und wir schauen in fröhliche Gesichter. Ein Kind wurde geboren und das halbe Dorf freut sich. Sichtlich stolz ist man, daß die zwei Reisenden auf den Stühlen Platz nehmen und dem Treiben zuschauen. Man winkt uns zu und ich kann nicht anders, als voller Verzückung zu schluchzen. Wenn ein Leben so beginnt, soll es ein glückliches sein. Und ich wünsche ihm von Herzen, dass es ebenso voller Freude und Hingabe lebt.
Wir sind Gefangene unserer deutschen Pünktlichkeit und stehen erwartungsvoll Punkt 14 Uhr am betreffenden Uferabschnitt des Volta-Sees in Kpando. Kein Pier, kein Steg, kein Schild, kein „gar nichts“ weist darauf hin, dass hier irgendwann eine Fähre kommen könnte. Zwei Holzboote im Schlamm blockieren derweil den Abschnitt und auf Nachfrage erweisen sie sich als die betreffende „Fähre“ (aah ja!) Man diskutiert darüber, ob sich eine Überfahrt bei der Passagierknappheit lohnt und kommt zum Schluß, dass sich das nicht lohnt. Aber eines der beiden Boote müsste sowieso auf die andere Seite des Sees – zur Wartung – deshalb könne man die 10 Passagiere irgendwie schon mitnehmen. Für uns wäre es halt doof, weil wir ja dann nicht mehr zurück kämen. Aber da gäbe es noch die Alternative, das andere Boot nebst Besatzung zu chartern und ein paar Inseln des Volta-Lakes zu umschippern. Und nach kurzen Verhandlungen sitzen wir auch schon in der „Peace of Man“ und tuckern über den See – hinein in dieses diesige Nichts.
Der Volta-See ist der größte, künstlich geschaffene Binnensee Afrikas und wurde in den 1960er Jahren angelegt, um das Land mit Wasser zu versorgen. Früher fanden sich auf seinem heutigen Grund Steppe, Waldgebiete und Dörfer, die man seinerzeit umgesiedelt hatte. Und ein paar Baumkronen, die immer noch aus dem Wasser ragen, sind Zeugen dieser Zeit und geben dem See etwas Märchenhaftes. Nach einer halben Stunde Fahrt treffen wir auch schon auf die erste Insel und tauchen ab in ein Parallel-Universum. Die Insel trägt im Uferbereich noch deutlich sichtbar, ihre Geschichte als früherer Waldabschnitt vor sich her und wird heute bewohnt von zwei Dutzend Insulanern, die ausschliesslich vom Fischfang leben. Ohne Strom und auf das Allernötigste reduziert, leben sie in kleinen Lehmhütten, offenbar fast unbemerkt vom Rest des Landes. Wir laufen dicht an ihren Hütten vorbei und ziehen natürlich alle Blicke auf uns. Ein herzlich gerufenes „Welcome“ macht es uns einfach, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und aus dem Gespräch, fällt es mir wiederum schwer zu glauben, daß es einige unter ihnen, in ihrem Leben schon mal weiter als nach Kpandu verschlagen hat. Ein Palmendach, unter dem eine Kreidetafel steht, dient als Schule und zwei kleine Mädchen pauken in der Tat gerade das Alphabet. Wir sind eine willkommene Abwechslung und sie zeigen uns voller Stolz was sie gerade gelernt haben.
Danach werden wir vom Dorfältesten (herzlich betrunken) begrüßt und er will wissen, wer wir sind und woher wir kommen. „German very good! Ah ah!“ – wir freuen uns, auch hier gut anzukommen und verlassen die Insel nach Gesprächen wie diesen, nach etwa einer Stunde Aufenthalt, allerdings nicht, ohne uns vom frisch geräucherten Fisch einen Beutel haben füllen lassen. Verhandlungsführend war Mama Viola (oder so), die keinen Zweifel darüber zuließ, dass ihr Fisch der beste auf der Welt sei und demnach ein mehr als angemessenes Salär zu zahlen wäre. Wir erwiesen uns jedoch als weniger harte Verhandlungspartner, was wiederum Mama Violas Salär möglicherweise verzehnfachte (man soll halt nicht mit hungrigen Magen mit dem Koch feilschen). Aber sei es drum… es traf nicht die Falsche! Und der Fisch war „yamyam“!
Die milchig-dunstige Sonne im Rücken legen wir ab und man winkt uns zum Abschied mit einem herzlichen Lächeln. Eine weitere Insel – nur wenige Minuten entfernt – taucht aus dem Nebel auf. Diesmal legen wir jedoch nicht an, sondern schippern langsam am Ufer entlang. Auch diese Insel scheint von einigen, wenigen Menschen bewohnt und unser Boot wird vom Ufer aus interessiert beobachtet.
Das gleichmäßige Tuckern des Außenborders und das Anschlagen der Wellen am Holzrumpf des Bootes, sind unser Soundtrack der nächsten Stunden. Und der sanfte Wind überm Volta-Lake macht die Hitze vergessen und gedankenversunken mit dem Blick im Horizont formt jeder für sich sein eigenes Bild des Tages. Ja, es gibt sie – diese Tage – die für immer bleiben. Mit Geschichten die man irgendwann später mal am Kamin an kalten Wintertagen erzählt, in der Hand einen Punsch…